• Die Frauen der APO
• Nicht von Dauer war die Mauer
• Die Katzen von Montmartre
• Kreuzberg – lieben leben kämpfen
• Wolfen Nord
• Menschen in Wolfen Nord
• Wiesbaden
• Frauen von Wiesbaden
• BaumArt
• Und nix wie raus zum Wannsee
• Die Zukunft ist weiblich
• Kultur der Frauengräber
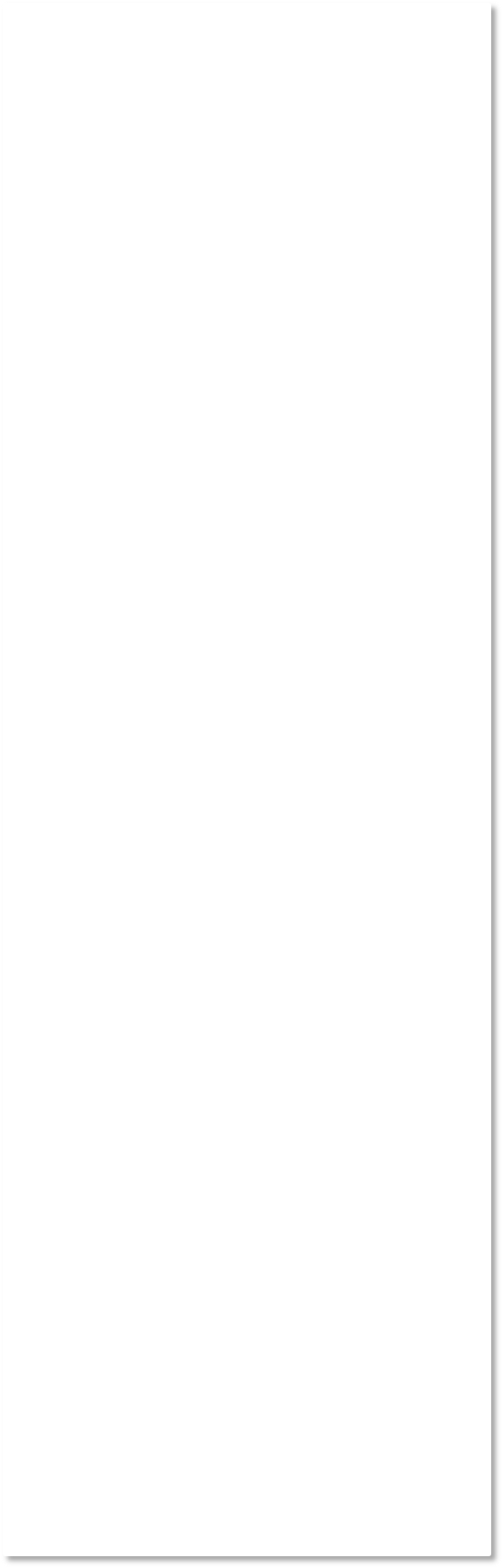
Ruth E.Westerwelle Nicht von Dauer war die Mauer : Fotogalerie Friedrichshain 4.8.2011
In wenigen Tagen jährt sich der Beginn des Mauerbaues. Vor fünfzig Jahren wurde die noch offene, aber schon vorhandene Grenze zwischen Ost und West-Berlin von einem auf den anderen Tag zu einem nur noch mit Lebensgefahr zu überwindenden Hindernis. Stacheldraht und schnelles Hochziehen von Ziegelwerk diente der DDR-Regierung dazu, die Bewegungsfreiheit der eigenen Bevölkerung rigoros einzugrenzen. Später wurde daraus der bekannte hohe Betonwall, der sich doppelseitig eines breiten Todesstreifens durchs urbane Mark zog. Paradoxerweise wurde dadurch auch West-Berlin vom Umland abgeschnitten und eingeschlossen. Doch war es ein besonderes Eingeschlossensein, ein kommodes, um Grass' auf die DDR-Diktatur gemünzte Formulierung einmal umzukehren. Bahn, Flugzeug, später Passierscheine und Visa erlaubten jederzeit eine Ortsveränderung. Aber natürlich veränderte die Mauer auch das Leben in dieser Halbstadt sehr ‒ in vielerlei Hinsicht. Das Leben mit ihr war eines gegen die Mauer, eines, das sich an ihr rieb, sie bekämpfte, unterlief; das sich allmählich an sie gewöhnte, sie übersah, sie verdrängte und verfluchte; aber auch ein Leben, das sich ihrer bediente, als Mahn- und Schandmal, das sie vorführte, als Touristenattraktion vermarktete, besprühte, bemalte, als Kulisse verwendete und sie schließlich damit in einen symbolischen Spiegel zeithistorischer Konflikte verwandelte, wie er in dieser Form einmalig auf der Welt war und wohl bleibt.
Die Fotografin Ruth E. Westerwelle lebte auf der westlichen Seite der Mauer. Ihre Aufnahmen sind vor allem eine visuelle Gegenüberstellung von Damals und Heute. Sie erinnern nicht an die Entstehung der Mauer, sondern ihre scheinbar unverrückbare, den städtischen Organismus zerschneidenden Existenz im Alltag. Sie erinnern an den sich wieder über Nacht ankündigenden Exitus der Mauer, erst noch ungläubig aufgenommene Verheißung, dann massenhaft und jubelnd gefeiertes Ereignis. Und schließlich, in einem weiteren Schritt, kommt das Heute ins Spiel, die spezifischen Orte, an denen die Mauer einmal stand und von ihr fotografiert wurden. Keine Mauer ist da mehr, aber Spuren hat sie hinterlassen ‒ bisweilen markante, bisweilen nur noch ahnbare. Doch alles sähe sicher anders aus, hätte es sie nicht gegeben. Westerwelles Fotos lassen Vergleiche zu, spannen einen Bogen zwischen dem Früher und dem Jetzt.
Die Idee zur jetzigen Ausstellung entwickelte die Fotografin Mitte der vergangenen Dekade. Im eigenen Auftrag, aber mit finanzieller Unterstützung von außen, fotografierte sie die Pendants zu ihren Mauer-Fotos der 1980er Jahre. Ergänzt um die Aufnahmen zur Maueröffnung entstand die Schau "Nicht von Dauer war die Mauer", die 2006 im Rathaus Kreuzberg und 2009 im Frauen-Museum in Wiesbaden zu sehen war ‒ und jetzt hier in Kreuzbergs Partnerbezirk, nicht weit weg von Spree und Oberbaumbrücke, die einmal die Grenze markierten. 2009 erschien im Eigenverlag auch das Buch zur Ausstellung. Dass der Fokus auf Kreuzberg liegt, ist kein Zufall. Er war der Bezirk mit der längsten innerstädtischen Mauergrenze. Er war und ist auch Westerwelles Wohnbezirk seit Jahrzehnten. Westerwelle ist aber nicht nur Fotografin, sondern vieles mehr. Als aktive Zeitgenossin der 68er-Generation unterhielt sie jahrelang eine bedeutenden Buchvertrieb für linke und alternative Verlage, war selbst Mitbegründerin zweier Kleinverlage, erforschte als Autorin und Fotografin umfassend Leben und Wirken der 68erinnen oder APO-Frauen, ist journalistisch und bildkünstlerisch aktiv, unterhält den von ihr gegründeten Berliner Foto-Salon und ist als Dozentin tätig.
Ihre lichtbildnerische Arbeit ‒ heute farbig, digital und zeichenhaft-abstrakt ‒ bewegt sich über viele Jahre hinweg zwischen den Bereichen Dokumentarismus und konzeptionelle Fotografie; auch Reportagen und Porträts, vor allem von Frauen, spielen eine gewichtige Rolle. Dokumentarisch erfasste Westerwelle das Alltagsleben in Städten wie der Plattenbausiedlung Wolfen, in Wiesbaden und West-Berlin. Diese und weitere Themen entstehen meist in Serien, denen oft ein bestimmtes inhaltliches und formales Konzept zugrunde liegt. In den Stadtfotografien können es die Menschen sein, die als Akteure des Straßenraums im Vordergrund stehen, zum anderen sind es die Dinge, die vom Leben und Wohnen künden: Mauern, Fassaden, Schilder, Graffiti, Plakate und Schaufenster – manchmal im Widerspruch zueinander, Ausdruck von Trends und Moden, von Partikularinteressen und Protestenergien. Ihre Impressionen aus dem Kreuzberg der 1980er Jahre stehen unter dem Motto "Liebe, Leben, Kämpfen" – ein für den Kiez typischer Wandspruch. Bethanien und besetzte Häuser, Eckkneipen und Markthalle, spielende Kinder und Straßenfeste, gesprühte Parolen und behelmte Polizisten ergeben ein buntes Bild in Schwarzweiß – darunter auch zahlreiche Mauerfotos.
Einige von ihnen haben Eingang in die jetzige Mauerschau gefunden, die sich in vier Kapitel teilt: "Kreuzberger Mauerzeiten" / "Kreuzberg mit und ohne Mauer, damals und heute" / "Maueröffnung in Kreuzberg" / "Maueröffnung und keine Mauer, damals und heute". Kreuzberger Mauerzeiten – der erste, einführende Teil – ist ganz dicht am Thema dran. Hier geht es weniger um das Umfeld, sondern um die Mauer selbst, um die Grenze – angekündigt durch Sektoren-Schilder –, die als brutaler Eingriff in die urbane Landschaft erscheint. Ein paar Beispiele: Die Mauer ist hoch: Die junge Frau, die ein angelehntes Drahtgitter bestiegen hat, reicht mit der Hand gerade an die bekrönende Rolle. – Die Mauer ist hoch, die Rolle läuft diagonal mitten durchs Bild, darüber ein Wachturm: Alles ganz nah, bedrohlich groß, einschüchternd. – Ähnlich im Foto mit Blick von der Waldemarstraße gen Osten: unten die Mauer als Querriegel, bemalt mit den berühmt gewordenen Kopfprofilen von Thierry Noir, dahinter Todesstreifen, Wachturm mit Besatzung, Häuser, Fernsehturmspitze. Fernrohr gegen Teleobjektiv: Der Grenzsoldat beäugt die Fotografin auf der Aussichtsplattform. – Eine solche bildet das Zentrum eines anderen Fotos, aufgenommen am Bethaniendamm. Viele gab es von diesen offiziellen Logenplätzen: Ausguck mit Gruseleffekt für Einheimische, Touristen und hohe Besucher.
Kreuzberg mit und ohne Mauer, damals und heute, der zweite Teil der Ausstellung, nimmt breiteren Raum ein. Hier kommt es zum Gegenüber: Grenz- und Mauerbild aus der Zeit der Teilung gegen den Blick aus neuerer Sicht. Die Fotografin hat die jeweilige Situation vom gleichen Standort aus und aus dem gleichen Blickwinkel erneut aufgenommen. Ein vorher – nachher der besonderen Art. Es verdeutlicht die Unterschiede zwischen dem Leben vor dem Mauerfall und danach. Es macht deutlich, wie stark die Mauer in das Stadtbild eingriff – damals – und wie heute alles ganz anders ist, oder auch nicht, wie eine Lücke bleibt, ein Phantomfeld, zugewuchert, überwachsen, ein Stück Naturraum in der Steinwüste. Fast gespenstisch erscheint sie bisweilen, die Konfrontation von damals und heute. Denn wo im oberen (oder linken) Foto, je nachdem, ob Quer- oder Hochformat, noch ein helles Band unbeirrt und schlangengleich sich durch den weiten Stadtraum schiebt, oder der Grenzwall mächtig randständig ins Bild drängt, da ist er unten (oder rechts) einfach verschwunden, im Zeitsprung restlos abhanden gekommen.
Diese Fotos aus der Serie von Gegenüberstellungen geben mehr vom Stadtraum wieder, häufig dem auf westlicher Seite, in manchen Fällen mit Blick Richtung Osten, der damals gleichsam durch die Mauer wie mit einer Sichtblende verstellt war, mal mehr, mal weniger. Ausnahmen bilden die Ansichten an der Spree. Hier, am Kreuzberger Gröbenufer, bildete der Fluss die Grenze. Der Blick zum Mühlendamm in Friedrichshain ist auf die Ost-Mauer am anderen Ufer gerichtet, die aber nur ein wissendes Auge als solche erkennen kann. Das Schild am Westufer mit der Aufschrift "Achtung Lebensgefahr. Wasserstraße gehört zum Ostsektor von Berlin" ist in der neuen Aufnahme verschwunden, nicht aber seine Halterung. Die Mauer drüben, die noch steht – gleich nach der Öffnung zur weltbekannten East Side Gallery mutiert –, wird von Baumbewuchs größtenteils verdeckt. Auch die Fernansicht der Oberbaumbrücke über die Spree, die als Grenzübergang diente, erschließt sich dem historisch geübten Auge mit Aha-Effekt. Der neugotischen Brücke sind wieder Türme aufgesetzt, und ein Ausflugsdampfer liegt am diesseitigen Spreeufer an. In der räumlich verdichteten Brückennahsicht dann werden die Unterschiede deutlicher. Im linken Bild Warnschild und Wachturm, im rechten fließender Verkehr und die neuen Brückentürme, im Hintergrund neue oder renovierte Gebäude.
Manchmal erschien die Mauer aus bestimmten Blickwinkeln wie ein integrierter Teil der Umgebung, die Begrenzung eines Geländes, dessen Bestimmung nicht einsichtig ist. Im Dreieck Dresdener, Waldemar- und Luckauer Straße zieht sich die bemalte Mauer träge durch eine herunter gekommene, vermüllte Stadtlandschaft. Noch heute wirkt die Gegend trostlos, trotz renovierter Häuser im neuen Glanz, und das naturbelassene Mauergelände verschwindet hinter aufdringlichen Werbetafeln. Als Störfaktor hingegen wirkt die Mauer am Bethaniendamm im Bild von der Thomaskirche, wo sie sich bedrohlich von rechts ins Bild neigt. Heute verschwunden, hat sich am Platz hinter dem Gotteshaus trotzdem wenig verändert. Die Rollheimer-Wagen sind weg, der türkische Garten, einst im Schatten der Mauer, kann sich nun frei entfalten.
In Kreuzberg stand die Mauer oft mitten auf einer ihrer Funktion beraubten Straße und verlief nur wenige Meter von den Westhäusern entfernt. Heute herrscht freie Fahrt, aus beengter, beklemmender Peripherie wurde Zentrumslage mit rauschendem Verkehrsfluss. Auch die Eisenbahnbrücke am Görlitzer Ufer, die das Kreuzberger Gelände des ehemaligen Görlitzer Bahnhofs mit Treptow verbindet, hat ihre Sperrung durch die Mauer verloren. Die Gleise sind ebenfalls verschwunden, die Brücke dient nun Fußgängern und Radfahrern. In Kreuzberg gab es, besonders an Waldemarstraße, Betanien- und Engeldamm, auch lange Mauerabschnitte mit viel freiem Gelände davor, die in den 1980er Jahren flächendeckend bemalt wurden und sich aus der Fernsicht zu einem einzigen langen Wandbild zusammensetzen. Aufgemalte politische Parolen wie "Volkszählungsboykott" geben hier Hinweise auf parallele zeithistorische Ereignisse. In den neueren Bildern sind die Brachen erhalten geblieben, naturbelassen oder ‒ wie im Falle des Kinderbauernhofes ‒ in gepflegte Wildnis umgewandelt.
Das Kapitel Maueröffnung in Kreuzberg zeigt die bewegenden Ereignisse nach dem 9. November 1989 und die folgenden Monate, als die Welt auf Berlin schaute, – hier konzentriert auf Kreuzberg mit gelegentlichen Ausflügen an andere Orte, wie das Brandenburger Tor oder den Potsdamer Platz, die meist im Fokus der Medien standen. Kleine Worte oder Dinge gewannen damals einen enormen Symbolgehalt, seien es die Schuhsohlen auf der Mauer und das hinzu gesprühte UMWERFEND, seien es die Trompete in der Hand der geschminkten Musikerin oder die hässliche, wundmalartige Öffnung in einer Mauer ‒ kein gewöhnliches Loch in einer gewöhnlichen Mauer, sondern ein Loch in der Mauer, die vierzig Jahre eine Stadt teilte und nun dahinschwindet. Die so genannten Mauerspechte sind kollektiv und eifrig am Werk. Der erste Mauerabriss beginnt im Juni 1990 in der Dunkelheit an der Ecke Waldemarstraße, Leuschner- und Legiendamm. Die mit Herz- und Königsköpfen verzierten Mauerteile werden abtransponiert. Die Mauer hat ihre obszöne Schuldigkeit getan.
Im Wahnsinns-November strömen die Menschen durch die Grenzübergänge zwischen Kreuzberg und Treptow, werden mit roten Nelken empfangen. Ostler und Westler schauen sich fassungslos an, nicht verstört, sondern aufgewühlt, freudig erregt, überwältigt im positiven Sinne. Prominente mischen sich unters Volk. Udo Lindenberg gibt Autogramme, ja, der echte, kein Double ‒ und Zille schaut vorbei, natürlich als schauspielerischer Wiederkehrer mit Zeichenmappe unterm Arm. Doch heutzutage fotografiert man natürlich, oder man filmt. So auch die winterlich schick angezogene ältere Dame im morastigen Mauergelände, die Kamera vorm Auge, während ein Grenzbeamter im Schutze eines mächtigen Lastwagens neben ihr steht ‒ einfach dasteht, statistenhaft wie Zille ‒ Beobachter nur noch einer Situation, die ihn bald überflüssig machen wird. Markant und symbolhaft ist Westerwelles Foto vom alten Westler, der nach Osten schaut. Noch teilt die im Querschnitt gesehene Mauer das Bild, teilt den unteilbaren Himmel. Fast lässig steht im Osten, aufragend, ein Grenzsoldat. Im Westen korrespondiert ihm ein elegant gekleideter, abwartender Mann. Davor steht der Alte mit Seemannsmütze und Ledermantel, lugt neugierig nach drüben. Zwischen ihnen hockt eine Frau mit Kamera. Der Osten ist offen, Eintritt frei in ein neues Kapitel der Weltgeschichte.
Das letzte Kapitel der Ausstellung heißt denn auch Maueröffnung und keine Mauer, damals und heute. Die alten Fotos stammen vom Sommer 1990 oder 1991, als die Mauer schon nicht mehr da war, aber ihr gewalttätiger Eingriff in den Stadtraum noch nicht kaschiert werden konnte. Monströs wirkt das Grenzkontrollgebäude am Checkpoint Charlie über der Friedrichstraße, dessen Dach jegliche Einsicht nach drüben versperrt. Gänzlich verschwunden, weitet sich der Blick im neuen Foto, moderne Büro- und Wohnhäuser im Osten verdichten die Innenstadt. Nicht zuletzt der Bus der Berliner City Tour im Bild erinnert daran, dass rechts und links zwischen Zimmer- und Mauerstraße noch offenes Gelände sich befindet mit Hinweisen auf die frühere Bedeutung des Ortes. In den beiden Bildern, die weiter weg vom Checkpoint Charlie Richtung Kochstraße aufgenommen sind, führt der Blick gleich frei in den Osten, im neuen Foto erscheint dann der, wie Westerwelle bemerkt, touristisch herausgeputzte Checkpoint Charlie.
Es fällt auf, dass das Fehlen der Mauer oft keine wesentlichen stadträumlichen Veränderungen hervorrief. Der ehemalige Todesstreifen zwischen dem westlichen Bethaniendamm und dem östlichen Engeldamm ist nun begrüntes Gelände, statt Mauer stehen beidseitig Bäume Spalier. War die Schillingbrücke einst abgesperrt und kopfsteingepflasterte Sackgasse, flutet nun der Verkehr ungehindert über sie hinweg, aber noch immer ist die Gegend Durchfahrtsgelände, unwirtlich und ohne urbanen Charme. Die Mauer – wo stand sie? Diese Frage sollte nicht nostalgisch, sondern geschichtsbewusst gestellt werden. Im Foto der Lindenstraße, deren Abschnitt heute Axel-Springer-Straße heißt, stand sie im Juni 1990 noch, später erinnert ein Pflastersteinstreifen an sie, leicht übersehbar und hier sichtlich überparkt. Historische Spuren zum Sprechen zu bringen, ist schwierig. Fotografie kann dabei – wie hier zu sehen – wichtige Geschichts- und Erinnerungsarbeit leisten. Michael Nungesser